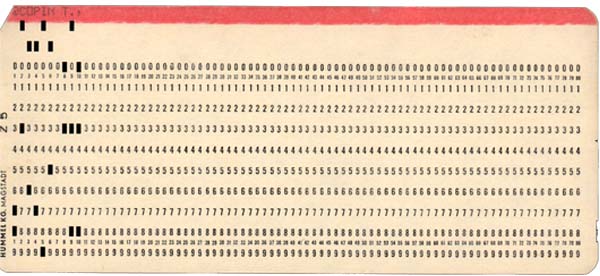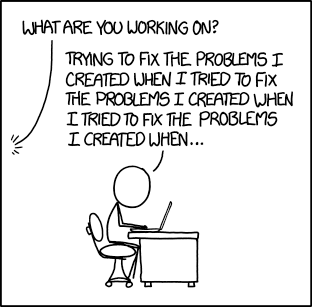Auf spektrum.de gab es vor nicht allzu langer Zeit einen Übersichtsartikel zu Microdosing, meint: der regelmässigen Einnahme psychoaktiver Drogen unterhalb der Wirkschwelle. Menschen machen das zum Zwecke der Gesundung oder zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Zu beidem gibt es deutliche Hinweise, dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Depressionen und Ängste sollen sich bessern, Konzentration und Kreativität zunehmen.
Schon einige Tage zuvor war mir das Thema im Rahmen einer Pilz-Doku („Die fantastische Welt der Pilze“ in der Mediathek) begegnet. Eine Suche im Netz bringt dann weitere Bewegtbildinhalte der öffentlich-rechtlichen Sender zutage, mal kurz, mal länglich-gesprächslastig. Und alles interessant vor allem unter einem Aspekt: der gesamtgesellschaftliche Zugang zum Thema Rauschdrogen in der Medizin scheint sich im Wandel zu befinden. Erstmals seit den 1970er Jahren gibt es wieder Forschung zum Thema und überall auf der Welt gibt es experimentelle Ansätze, Drogen in Therapien einzubeziehen.
Im Wesentlichen gibt es zwei Ansätze. Erstens werden Drogen im Rahmen eines gesicherten Settings verabreicht, der anschließende Rausch begleitet und in den Folgesitzungen aufgearbeitet. Die Anzahl der „Rausch-Sitzungen“ liegt im einstelligen Bereich. Im zweiten Ansatz werden sehr kleine Dosen psychoaktiver Drogen (deswegen Microdosing, wer hätte es gedacht) regelmäßig über einen längeren Zeitraum eingenommen. Dosierung und Einnahme liegen in der Verantwortung des Konsumenten. Dabei soll es zu keinem Zeitpunkt zu einer Veränderung der gewohnten Wahrnehmungsweise kommen, wer einen Rausch wahrnimmt, hat zu hoch dosiert.
Klare Sache, wer als Betroffener den Trip auf Krankenschein sucht, wird ihn so schnell nicht bekommen. Zufall und Glück müssten ihn in eine der wenigen klinischen Studien oder zu einem der wenigen zugelassenen Therapie-Plätze führen. Insgesamt keine guten Erfolgsaussichten. Hat aber auch sein Gutes: wir müssen uns nicht mehr kümmern.
Eine bessere Chance bietet da Microdosing als Selbsthilfe. Auch das ist nicht ohne jede Schwierigkeit und vermutlich taucht gelegentlich die eine oder andere Sorge auf, die dann behandelt werden will. Kurz, bevor wir zur selbsthelfenden Tat schreiten, müssen wir uns kümmern, Risiken abschätzen, Vorgehensweisen klären, viel lesen und verstehen
Wenn ihr mir bis hierher gefolgt seid empfehle ich dringend, den oben verlinkten Artikel zu lesen, jetzt. Damit wir auf dem gleichen Stand sind und ich mich darauf beziehen kann. Wenn ihr gerade keine Zeit habt, dann hört einfach auf zu lesen und kommt wieder, wenn ihr Zeit habt. Ansonsten: Jetzt.
Oder ihr macht, was ihr wollt.
<O>
Was haben wir erfahren? Microdosing ist ein Trend, Die MD-Community ist von den positiven Effekten überzeugt. Dennoch: nichts genaues weiß man nicht. Microdosing scheint ungefährlich zu sein, im dümmsten Fall könnten wir es mit einem Placebo-Effekt zu tun haben. Andererseits lassen sich Wirkprinzipien benennen und schwache Effekte sogar messen. Weitere Forschung ist dringend notwendig.
Im Ergebnis scheint das zunächst etwas dünn. Was daran liegen könnte, dass der Artikel nah an seinem Thema, dem Microdosing, bleibt, während ein Großteil der Forschung sich auf den Einsatz wirkkräftiger Dosen im Rahmen konventioneller Therapien konzentriert (und dabei sehr viel überzeugter auftritt, gelegentlich sogar von „breakthrough therapies“ spricht).
Zurück zur Selbsthilfe. Als Depressionskandidat wäre ich verzweifelt genug, Microdosing eine Chance zu geben. Wenn ich denn nur wüßte, wie genau das eigentlich funktioniert. Das im Artikel angesprochene Reddit-Forum erweist sich als eine großartige Informationsquelle. Ich vermute ein Großteil der oben angesprochenen Sorgen und Ängste werden dort behandelt. Wie hoch ist eigentlich eine Micro-Dose? Welches Einnahme-Schemata gibt es? Was hilft bei Magenschmerzen oder allgemeinem Unwohlsein nach der Einnahme? Solche Fragen werden dort behandelt.
Was dort nicht behandelt wird sind Fragen der Beschaffung und was der Staatsanwalt deines Vertrauens eigentlich dazu sagt. Und das sind ja doch sehr wesentliche Fragen.
Auch der Spektrum-Artikel sagt dazu nichts, muss er auch nicht aus seiner wissenschaftlichen Perspektive heraus. Aber spätestens wenn man das Reddit-Forum besucht hat, fällt auf, dass der Artikel Psylocybin unterrepräsentiert und nur nebenbei erwähnt („Neben LSD nutzen die Betroffenen auch Psilocybin, den Wirkstoff der »magic mushrooms« […].“ Sehr viel später im Text dann „[…] Psilocybin und LSD […] binden an einen bestimmten Serotoninrezeptor namens 5-HT2A.“). In der Microdosing-Community spielt Psiylocybin eine deutlich größere Rolle. Der Mangel an Erwähnung im Artikel ist schade, weil eine Suche nach psylocybinhaltigen Pilzen (in der Suchmachine, nicht im Wald) durchaus interessante Ergebnisse bringt, auch und gerade in Bezug auf Fragen der Beschaffung und der Legalität.
Man sollte denken, die Sache mit der Legalität sei relativ schnell geklärt. Die für das Microdosing in Frage kommenden Substanzen LSD und Psilocybin dürfen weder gehandelt noch besessen werden, wenn die treibende Kraft dahinter Rausch, Vergnügen oder Selbstverbesserung ist. Das gilt auch, wenn die Substanz, wie im Falle von Psilocybin, noch im Pilz ist. Ende aller Microdosing-Fantasien.
Aber wartet, vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört, dass manche Sorten von französischen Schimmelkäse nach deutschem Lebensmittelrecht nicht zulassungsfähig wären. Aber weil sie in Frankreich zugelassen sind, dürfen diese Käsesorten auch in Deutschland gegessen werden. Okaaay, falls es nicht wahr ist, ist es gut erfunden.
So ähnlich auch hier, Wikipedia schreibt im Artikel zu psilocybinhaltigen Pilzen zur Rechtslage in den Niederlanden:
Das Verbot betrifft psilocybinhaltige Pilze, während psilocybinhaltige Trüffel und Pilzzuchtsets verkauft werden können. Am 13. September 2019 veröffentlichte die Steuerbehörde der Niederlande die zollrechtliche Kategorisierung und den dazugehörigen Steuersatz für magische Trüffel und hat diese damit als Genussmittel legalisiert.
Manche schließen daraus: Magische Trüffel sind seit 2019 dank Holland ein in der EU anerkanntes und legales Genussmittel in jeder Mengenordnung. So oder ähnlich steht das auch auf den Seiten mancher Versender. Dem Einen sein Käse ist des Anderen Trüffel.
Aber kann das sein? Wenn es um rechtliche Fragen geht, verlasse ich mich doch lieber auf Anwälte, diese hier und nur zum Beispiel:
„Auch wenn Anbieter von magischen Trüffeln etwas anderes behaupten: Psilocybin und Psilocin sind in der Anlage 1 zum Betäubungsmittelgesetz (BtMG) aufgeführt. Damit ist jeglicher Umgang mit Pilzen oder deren Bestandteilen in Deutschland verboten und nach § 29 Absatz 1 BtMG strafbar.
Die Begründung für die angebliche Legalität in Deutschland lautet: Die niederländische Steuerbehörde habe für die Trüffel 2019 einen Steuersatz veröffentlicht und sie damit für verkehrsfähig erklärt.
Es ist aber ein Trugschluss, dass aufgrund des gemeinsamen EU-Binnenmarktes damit automatisch eine Legalisierung in allen anderen Staaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone (EFTA) verbunden ist. In Deutschland gilt weiterhin die bisherige Rechtslage und damit das Verbot nach dem Betäubungsmittelgesetz.“
Und damit ist jede Aussicht auf legales Microdosing in Deutschland vom Tisch. Sehr schade, das!
Im nächsten Leben werde ich Holländer, dann könnte ich mir dort einen der vielen Smartshops googlen, mir total legal magische Trüffel kaufen und was gegen meine Depressionen tun. Nur mal so zur Abwechslung.